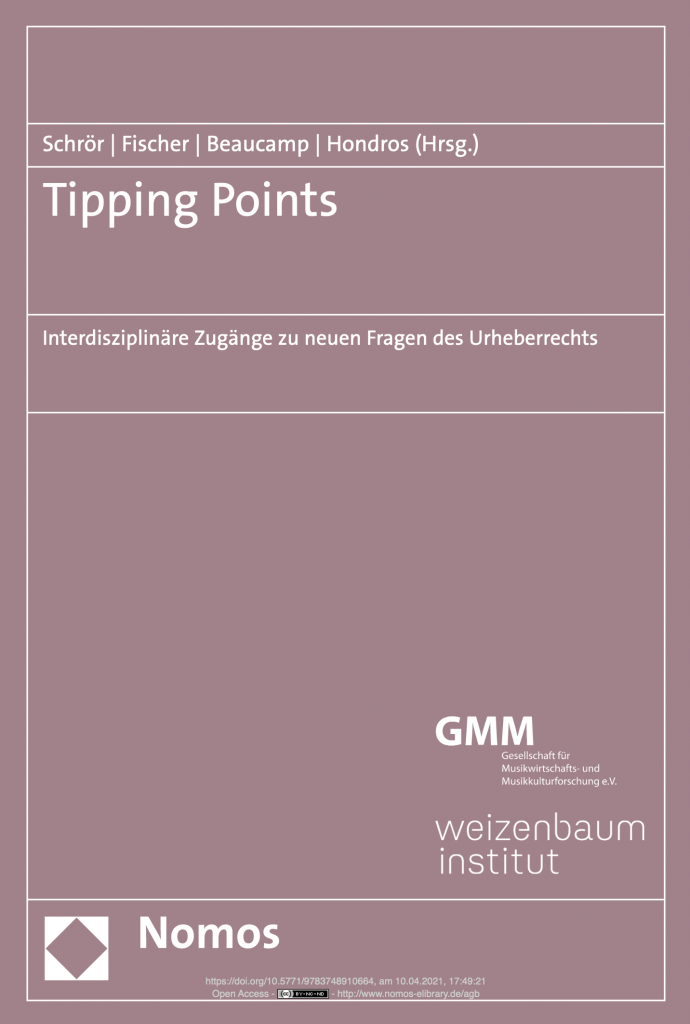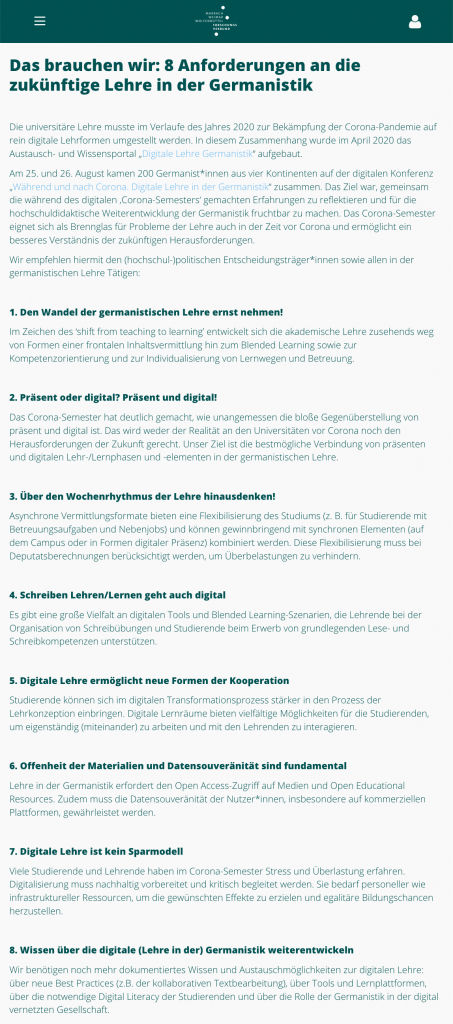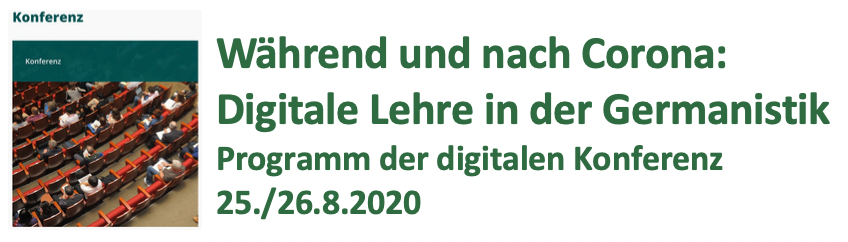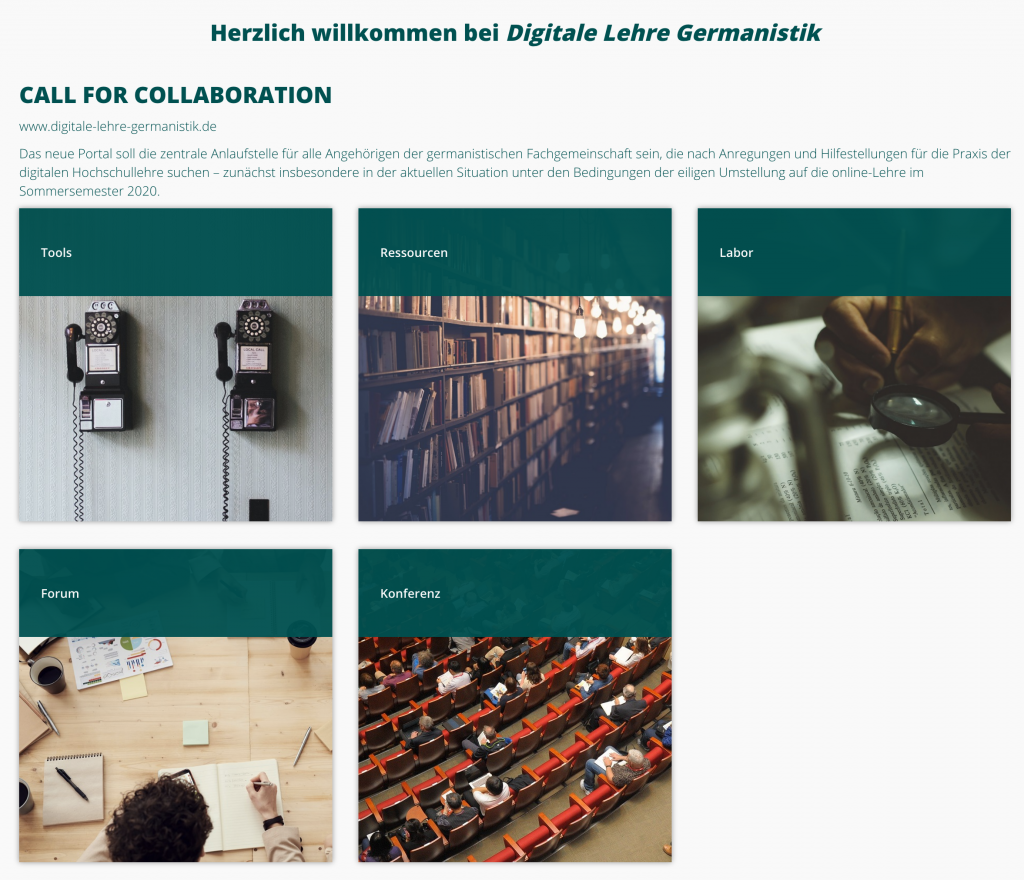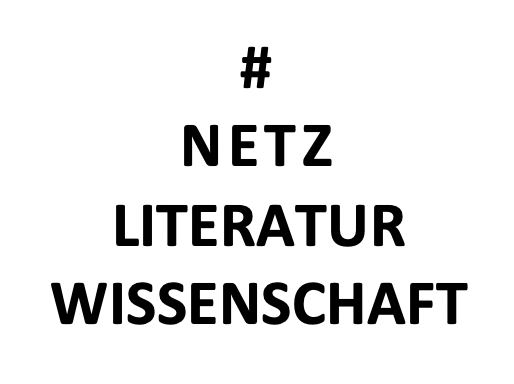
Vom 6.-8.9.2021 wird die Online-Konferenz „Netzliteraturwissenschaft: Was wissen wir? Wie wissen wir? Was wollen wir wissen?“ stattfinden. Ich freue mich sehr, dass einige zentrale Forscher*innen dieses Feldes ihre Teilnahme zugesagt haben, es gibt jedoch weitere Möglichkeiten zur aktiven wie zur passiven Teilnahme.
Vorgesehen ist, dass die Konferenz aufgezeichnet und ggf. gestreamt wird, die Möglichkeit zur passiven Teilnahme ist also gegeben. Wer aktiv teilnehmen und mitdiskutieren möchte, kann sich bis Ende August als „geladene*r Diskutant*in“ anmelden. Wenn Sie einen Projektpitch oder Kurzvortrag beitragen möchten, können Sie sich dafür in einem kurzen Zeitfenster und bis spätestens zum 3.8.2021 bewerben. Informationen dazu finden Sie hier, nutzen Sie bitte den Bewerbungsbogen.
Das Konferenzprogramm wird in der ersten Augustwoche finalisiert und Mitte August auf der Projektplattform netzliteraturwissenschaft.net (in Vorbereitung) veröffentlicht. Dann erhalten Sie auch weitere Informationen. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos, sie wird unterstützt von der vDHd2021, dem Departement Letterkunde der Universiteit Antwerpen sowie der Amsterdam School of Cultural Analysis an der Universiteit van Amsterdam. Das Konferenz-Hashtag lautet #NetzLW21, die allgemeinen Hashtags #Netzliteraturwissenschaft und #NetzLW.